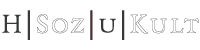
Transnationale Geschichte, so wird beim Lesen des dem Historiker Jürgen Kocka zum 65. Geburtstag gewidmeten Bandes deutlich, bedeutet nebst anderem eine „vielfältige Entgrenzung des historischen Gegenstandes“(S. 12). Neue Kommunikationstechnologien und -netzwerke haben neuen Formen des Austausches und des Kulturtransfers über nationale Grenzen hinweg an Intensität verliehen – dies gilt nicht zuletzt auch für die Intensivierung internationaler Wissenschaftsnetzwerke und länderübergreifender Forschergemeinschaften. Der Verdienst des Bandes ist es, die in einem solchen Kontext entstehende Bandbreite an Themenfeldern und wissenschaftlichen Ansätzen aufzuzeigen, welche an eine transnationale und welthistorische Perspektive anknüpfen: vom historischen Vergleich über die Postcolonial Studies bis hin zur Globalgeschichte. Während im ersten Teil wichtige Konzepte transnationaler Historiographie präsentiert werden, kommen im zweiten Teil ausgewählte Felder der Geschichtswissenschaft zum Zug. Der zweisprachige Band (englisch und deutsch) versteht sich als „Zwischenbilanz“ – ein treffender Ausdruck für einen Sammelband, der ein dermaßen breites Spektrum an Themen abdeckt. Umso mehr finden sich darin manche Trouvaillen und konzis gebündelte Einblicke in unterschiedliche Zugänge zur transnationalen Geschichtsschreibung und globalgeschichtlichen Fragestellung. Die Entgrenzung des historischen Gegenstandes lässt sich in dem vorliegenden Band anhand zweier Beispiele – den Subaltern Studies und der transnationalen Dimension der Holocaust-Erinnerung – verdeutlichen.
In seinem Beitrag „A Brief History of Subaltern Studies“ erinnert der Anthropologe Partha Chatterjee an die Geschichte und Wirkungen der Schriften einer Gruppe von Historikern und Historikerinnen des modernen Südasiens in der Reihe Subaltern Studies, deren Publikationen erstmals 1982 erschienen. Zwar verweist die Namensgebung der Gruppe (South Asian Subaltern Studies Group) bereits auf die intellektuelle Anleihe an den italienischen Marxisten Antonio Gramsci. Die Subaltern Studies adaptierten Gramscis Begriff in mehrfacher Hinsicht, veränderten ihn aber auch zugleich: In einer der Verwendungen des Begriffes verwies Gramsci auf die subalternen – den herrschenden Klassen untergeordneten – Menschen in präkapitalistischen Sozialformationen, die politisch unorganisiert waren und keiner hegemonialen Klasse angehörten. Trotz der Betonung einer distinkten Kultur der Subalternen, verwies Gramsci auf das fragmentierte, passive Bewusstsein der Subalternen im Vergleich zum Aktivismus und Originalität der herrschenden Klasse.
Genau an diesem Punkt setzten die Historikerinnen und Historiker um die Subaltern Studies an. In produktiver Weise störten sie sozusagen die klare Ordnung der Welt, wenn sie die von kolonialen und bürgerlich-nationalen Eliten dominierte indische nationale Historiographie herausforderten. Die Gruppe hinterfragte die Erzählung vom antagonistischen Kampf zwischen den bürgerlich-nationalen Eliten und der kolonialen Hegemonie. Die Entwicklung eines nationalen Bewusstseins war in dieser Version ein Produkt der verschiedenen Eliten. Ranajit Guha, Herausgeber der ersten Bände der Subaltern Studies, betonte, dass eine derartige klassenbezogene Sichtweise die „politics of the people” völlig ausblende. Der Fokus richtete sich fortan auf andere Protagonisten, die Kampfschauplätze wurden pluralisiert – und die „Geschichte von unten“ sollte neu geschrieben werden. In diesem Zusammenhang rückte die Frage nach der „Autonomie des subalternen Bewusstseins“ in den Vordergrund. In dieser „Gegengeschichte“ (Guha) spielten die indischen Massen nicht einfach eine passive, von den nationalen Eliten Indiens abhängige Rolle, ebenso wenig wie ihr politisches Bewusstsein erst in der Begegnung mit nationalen Führern geweckt wurde. Wesentlich war, dass beide Lager höchst unterschiedliche Erwartungen an, Strategien und Methoden innerhalb des anti-kolonialen Kampfes hatten. Die Subalternen zeichneten sich durch eine „distinkte Struktur des subalternen Bewusstseins“ aus, die sich aus Unterdrückungserfahrungen heraus entwickelt hatte. Sichtbar, so die neue Perspektive, wurde dieses unabhängige Bewusstsein nur in Momenten der Revolten und Aufstände – denn die Archive verwalteten nur die Stimmen und Spuren der dominanten Gruppierungen. Vor allem die Dokumente zu den ländlichen Revolten, in denen die Betroffenen selten eigenständig zu Wort kamen, sollten gegen den Strich gelesen werden, um nicht der Perspektive der Funktionäre, Beamten und Eliten verhaftet zu bleiben.
Kritik an den Ansätzen der Subaltern Studies ebenso wie eine Reorientierung innerhalb dieses Feldes ließen nicht lange auf sich warten. Die Annahme eines “autonomen subalternen Bewusstseins" wie auch die Vorstellung von den Subalternen als “aktive historische Protagonisten" wurden hinterfragt. Warum sei es nötig, wie es Gayatri Spivak formulierte, die Subalternen als souveräne Subjekte und „Macher/innen“ der Geschichte zu konstruieren? Spivak warf den Subaltern Studies vor, sich an der Reproduktion kolonialer Wissensregimes zu beteiligen, indem sie die subalterne Handlungsmacht in ein bürgerlich humanistisches Modell einschrieben.[1] Ebenso betonte sie, dass der Suche nach der authentischen Stimme der Marginalisierten eine romantische Annahme zugrunde liege. In einer Neubewertung seit Ende der 1980er-Jahren wurde das zuvor als homogen betrachtete subalterne Bewusstsein als fragmentarisch und unvollständig, als konstituiert durch die Erfahrungen der dominanten wie auch der unterworfenen Klassen verstanden. Zudem entwickelten sich – in Zusammenhang mit der Frage nach der „Repräsentation des Subalternen“ – neue Forschungsgegenstände und -methoden wie etwa die Frage nach der Verbreitung von modernem Wissen über englische Bildungsinstitutionen, nach den Sozialreformen oder dem Aufstieg des Nationalismus.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse jedoch bereits in der frühen Phase der Subaltern Studies war – und dies spielte schließlich für die Entwicklung der Postcolonial Studies eine wichtige Rolle – die Weigerung, sich in die Version der „westlichen Moderne“ einzuschreiben. Nach der europäischen Version gab es zwar eine „Geschichte von unten“, die jedoch angesichts des durchschlagenden Erfolges der kapitalistischen Moderne immer als „Tragödie“ endete, wie Chatterjee erinnerte. Die Subaltern Studies hingegen nahmen eine andere Wendung, die schießlich als „other modernities“ in die Historiographie einging: Was für den Westen mit ihren Modernisierungstheorien galt, musste im Rest der Welt keine bzw. eine andere Gültigkeit haben. Musste die Geschichte nichtwestlicher Gesellschaften immer als Geschichte des „Aufholens“ oder der „Hinterherhinkens“ geschrieben werden – consigned for ever to „the waiting room of history“, wie es der Anthropologe Dipesh Chakrabarty treffend ausdrückte? Oder als „deviante“ oder „korrupte“ Moderne? Oder waren sie nicht vielmehr ein lebendiges Beispiel für eine „andere“ Moderne?
Die „Subalternität nichtwestlicher Geschichten“, darauf verwies Chakrabarty, spiegelt sich bis heute nicht nur in der Ignoranz europäischer Historiker und Historikerinnen die Geschichtsschreibung der so genannte "Dritten Welt" wahrzunehmen; sie zeigte sich auch in deren über lange Zeit unangefochtenen Anspruch, universalgültige Theorien aufzustellen.[2] Im Spiegel der Geschichte der Moderne figurieren die Tropen der „Unvollständigkeit“, der „Unzulänglichkeit“ und des „Scheiterns“, wenn es um die Geschichtsschreibung über die nichtwestliche Welt gehe; daran nähmen Europäer wie auch indische Geschichtsschreiber teil. Chaterjee selbst hat in einer Untersuchung gezeigt, dass in den nationalistischen Versionen dieser Erzählungen die Arbeiter und ländliche Bevölkerung als Repräsentanten der Subalternen figurierten, die auf dem Weg in die Moderne aus ihrer Ignoranz oder „falschem Bewusstsein“ befreit werden mussten.[3] Den modernen Staat bzw. den Nationalstaat zu denken hieße immer, Europa als theoretisches Subjekt in den Vordergrund zu rücken. Dass nichtwestliche Kulturen innerhalb eines kolonialen Settings importierte bürgerliche Vorstellungen (von privat/öffentlich usw.) jeweils lokal abwandeln oder eigenständig adaptieren konnten, wurde lange nicht in Betracht gezogen. Die „koloniale Matrix“ der modernen Geschichte blieb europäisch-partikular in ihrer Genesis und universal in ihrer Geltung. Die Moderne wurde, in den Worten der australischen Kulturwissenschaftlerin Meaghan Morris, als eine „bekannte Geschichte“ verstanden, die bereits anderswo geschehen ist und lediglich auf mechanistische Weise mit lokalen Inhalten gefüllt wurde.[4] Konkret bedeute dies, dass im Zuge der Aufklärung die Moderne mit der Heraufkunft des Nationalstaates in der Geschichtsschreibung immer einen privilegierten Platz einnehmen würde und Europa als die „Urheimat“ des Modernen dominant bleibe. Das Projekt der „Provinzialisierung Europas“ – des „Europas“, wie Chakrabarty erinnert, das durch den modernen Imperialismus und Nationalismus in der „Dritten Welt“ in gemeinsamer Verbundenheit und Gewaltanwendung universalisiert wurde – heißt nicht die Perspektive des Modernisierungsparadigmas einfach umzudrehen, ebenso wenig eine pauschale Ablehnung der Moderne, der Vernunft, der großen Erzählungen oder ein kultureller Relativismus. Das Projekt bedeutet zuvorderst anzuerkennen, dass die Gleichsetzung einer spezifischen Version Europas mit der „Moderne“ der historischen Realität nicht genügt, und dass Kolonien und Metropolen jeweils in komplexen Wechselbeziehungen zueinander stehen – die Moderne folglich nicht das alleinige Werk von Europäern darstellt. In diesen Ansätzen werden Beziehungen und Konstellationen über die nationalen Grenzen hinweg besonders deutlich, wie es der Begriff „transnational“ suggeriert.
Die gegenwärtige Welt scheint (zumindest auf den ersten Blick) noch immer geprägt von starken ökonomischen und sozialen Ungleichheiten und die grobe Teilung, so behaupten viele, entläuft noch immer entlang der Linien der Menschen aus dem „Westen“ und „Nicht-Westen“ – eine Teilung, die im 19. Jahrhundert durch die Expansion der europäischen Kolonialmächte mit Hilfe von rassischen Theorien und Gewaltanwendung absolut gemacht wurde. Trotz Dekolonisation findet sich bei einem Großteil der Großmächte eine erstaunliche Kontinuität; dieselben (ex-)imperialen Länder dominieren – wenn auch mit anderen Mitteln als früher – die ehemaligen von ihnen beherrschten Kolonialländer: Die entstehenden Konturen einer transnationalen, postkolonialen Weltordnung „tragen noch die Spuren ihrer imperialen Vorgeschichte“.[5] Dennoch gibt es wichtige Verschiebungen in der globalen Machtbalance: Die ehemaligen Kolonialmächte beispielsweise sind heute mehr denn je auf billige Arbeitskräfte aus den Ländern angewiesen und nur schon als ein Resultat von Immigration lässt sich die klare Trennung zwischen dem „West and the Rest“ nicht mehr ohne weiteres Aufrecht erhalten.
Hiermit werden auch die Verknüpfungspunkte der Subaltern Studies zu den Postcolonial Studies, die sich zunächst vor allem im englischsprachigen Raum entwickelten, erkennbar – auch wenn sie keine einheitliche Theorie liefern. Die historischen Untersuchungen über die Produktion hybrider kultureller Formen in den unterschiedlichsten Regionen der ehemaligen kolonialen Welt sind ein Ausdruck davon. Vor allem haben die Postcolonial Studies aber auch die Frage nach den kolonialen Verflechtungen und Rückwirkungen auf die europäische Geschichte bis in die postkoloniale Zeit hinein aufgeworfen. Die koloniale Erfahrung gilt folglich nicht nur für alle Gesellschaften, sondern hat auch bis in die Gegenwart Auswirkungen, was etwa am Beispiel von diasporischen Immigrantenkulturen mehrfach untersucht wurde. Gleichwohl existiert ein Unterschied zwischen den Subaltern Studies und den Postcolonial Studies: Erstere handeln im Wesentlichen nicht von der Beziehung Europas zur außereuropäischen Welt, sondern haben ihren Fokus auf Südasien und auf kommunale Konflikte wie etwa im kolonialen Indien, der Geschichte der Teilung Indiens oder die ethnischen Konflikte Sri Lankas. Dies deutet auf einen weiteren wichtigen Punkt hin, den bereits Aijaz Ahmad betonte: Ein Großteil des Archivs, in dem das „Wissen“ über die „Dritte Welt“ entsteht, wurde und wird in den (Forschungs-)Institutionen der Metropolen generiert. Genau an diesem Punkt versuchten die Vertreterinnen und Vertreter der Subaltern und Postcolonial Studies, einen neuen Weg zu gehen. Ihre Positionen, daran erinnert Chatterjee ebenso, entwickeln sich „with the full responsibility demanded by considerations of practicality and institutional realism. […] subaltern history in South Asia has to work within the realist confines of national politics, even as it offers critique" (S. 102).
Die Erweiterung der Forschungsfelder der Subaltern Studies auf Themen wie „resistance“, Kaste oder Geschlecht, religiöse Minderheiten, zeigen die dynamische Weiterentwicklung dieser Forschungsrichtung. Ebenso findet eine Neubewertung lang anhaltender modernistischer Ideen wie Citizenship, Nation oder Demokratie – etwa angesichts der anhaltenden prekären sozialen Position von Frauen – statt. Zudem ist die Übertragbarkeit von Konzepten wie das der „Subalternität“ etwa auf die lateinamerikanische Situation noch immer von großer Aktualität.[6] Bei der fast inflationären Anwendung des Begriffes „postkolonial“ scheint es umso wichtiger, diese frühen und einflussreichen Stimmen der Subaltern Studies bezüglich den Debatten um Kontinuitäten und Diskontinuitäten des Kolonialismus in Erinnerung zu rufen. Für die Überwindung der Nationalfixierung haben sie zweifelsohne einen wichtigen Beitrag geliefert.
Dass auch Erinnerungen eine transnationale, multinationale Perspektive erhalten können und sich dadurch nicht nur das Objekt der Erinnerung, sondern auch die sich erinnernden nationalen Kollektive verändern können und der nationale Rahmen im Zuge der Erinnerungsarbeit überschritten wird, zeigt der israelische Historiker Moshe Zimmermann in seinem Beitrag zur „transnationalen Holocaust-Erinnerung“. Spätestens mit dem 2001 erschienenen Buch „Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust“ von Daniel Levy und Natan Sznaider hat das Thema auch im deutschsprachigen Raum eine breitere Öffentlichkeit erreicht. Auch Klassen, Kirchen und andere Kollektive partizipieren, neben Nationen, an der Holocaust-Erinnerung und funktionalisieren sie für je eigene Zwecke, so Zimmermann. (S. 203) Die Monopolstellung der jüdischen Gedenkform an den Holocaust – wie sie etwa in den Zeremonien zum 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz im letzten Jahr deutlich wurden – droht mehrfach in Frage gestellt zu werden. Überblicksartig zeichnet der Autor diese Veränderungen nach: Nachdem zeitlich verzögert in einer ersten Phase das Bewusstsein um die millionenfache Ermordung der Juden nach dem Zweiten Weltkrieg erst einmal ins Bewusstsein getreten war, wurde bald einmal der jüdische bzw. israelische Versuch erkennbar, das singuläre Phänomen zu monopolisieren und die Anwendung des Begriffes „Holocaust“ (trotz seiner umstrittenen ursprünglichen Bedeutung) oder „Shoah“ als Alleinanspruch für das Leiden der jüdischen Opfer des Zweiten Weltkrieges zu definieren.[7] Eine konkurrenzierende Rezeption der Holocaust-Erinnerungen drängte sich in einer zweiten Phase vor allem seit den 1990er-Jahren auf: Nicht nur die berühmten Debatten um die Opfer des Stalinismus, sondern auch auf Polen, Ruanda, Armenien, Vietnam, Palästina und andere Konflikte und Genozide bezogen, wurde der Begriff nun vermehrt verwendet.[8] Der Höhepunkt fand in den neuerlichen umstrittenen Bestrebungen innerhalb der deutschen Geschichtsschreibung statt, die Nation der Täter in Opfer eines Holocaust stilisieren zu wollen. Jörg Friedrichs Buch „Der Brand“ (2002) und die darin enthaltene Rede vom „Bombenholocaust“ bezüglich der deutschen Opfer verdeutlicht, dass die Transnationalisierung der Erinnerungen an die Holocaust-Opfer kaum noch nachvollziehbare, zuweilen gar absurde Dimensionen erreicht. Deutlich macht Zimmermann, dass die Holocaust-Erinnerung einerseits immer vom historischen Kontext abhängig ist, andererseits auch mit materiellen Erwägungen zusammenhängt. Schließlich spielt auch die vielerorts konstatierte „Amerikanisierung“ bzw. "Hollywoodisierung" des Holocaust eine wichtige Rolle in der Veränderung der Erinnerungslandschaft.[9] Die Medialisierung des Holocaust durch Filme wie „Schindler's List“ (1993) sind untrügliche Zeichen der Zeit: „Shoah business is big business”. Der Holocaust ist spätestens seit Spielbergs Film aus der Kulturindustrie kaum mehr wegzudenken. Dies deutet auch auf eine Veränderung der sich erinnernden Kollektive hin: Waren und sind die Hauptträger der Holocaust-Erinnerung hauptsächlich Juden bzw. Israelis und Deutsche, ist seit dem Ende der 1970er-Jahre die Rolle der USA zumindest in ihrer gestaltenden Funktion der Erinnerungen an den Holocaust unverkennbar – dies vor allem seit Ausstrahlung der Filmserie „Holocaust“ (1978). Während Hollywood bereits seit längerer Zeit das Nazibild – viel stärker als die Berufshistoriker/innen, wie Zimmermann behauptet – präge, setze sich nun allgemein eine „Amerikanisierung des Holocaust“ durch. Für den Prozess der Transnationalisierung der Holocaust-Erinnerung bedeute dies – trotz massiver Kritik an der Trivialisierung und Kommerzialisierung des Schreckens – einen entscheidenden Schritt: „So errang Amerika in der Holocaust-Erinnerung eine hegemoniale Stellung, die die partikularen Erinnerungsmuster von Israelis, Deutschen oder anderen Nationen überblendete“, so Zimmermanns Fazit. Manche sprechen gar von einer „Entortung“ des Holocaust, was ihn zu einer universalen Leidensgeschichte mache. Die Staaten verlieren an Einfluss, konkurrierende Geschichten existieren parallel und Massenkultur wie auch transnationale Medien lösen den nationalen Rahmen zunehmend auf.“[10]
Dies deutet darauf hin, dass nicht nur eine Verschiebung auf der Ebene der sich erinnernden nationalen Kollektive, sondern auch eine Entgrenzung der nationalen oder kollektiven Erinnerungen zu beobachten ist. Erkennbar wird das etwa am Beispiel der Black History. Der Religionswissenschaftler Hubert Locke beispielsweise ficht keineswegs die Einzigartigkeit des Holocaust an, fordert aber die Möglichkeit eines Vergleiches mit anderen Kollektiven und die Bedeutung des Holocaust jenseits der jüdischen Nation – etwa für die Schwarz-Amerikaner – anzuerkennen. In einem derartigen Verständnis diene die Erinnerung an den Holocaust als eine universelle Mahnung gegen Rassismus und andere Botschaften mehr.[11] Deutlich wird an diesem Beispiel, dass die Holocaust-Erinnerung sich transnational mittlerweile als ein „Muss“ etablieren konnte, auch wenn unterschiedliche Adaptionen und Interessen in verschiedenen Regionen der Welt vorherrschen.
Während der Band eine spannende Auswahl an Perspektiven und Themenfeldern liefert, wird eingehend nicht näher erläutert, worin „transnationale Geschichtsschreibung“ genau besteht; diese Unklarheit mag am Genre der „Festschriften“ liegen, mag aber höchstens einem Fachpublikum genügen. Für manche/n Leser/in wird die Frage auftauchen, was denn nun diese mannigfaltigen Perspektiven im innern zusammenhält: Ist es die verfremdende Perspektive auf ein vermeintlich vertrautes Phänomen? Oder die immer wiederkehrende Frage nach dem Stellenwert des Nationalstaates, wie die Herausgeber und Herausgeberin im Vorwort erwähnen? Der „transnational turn“, so lautet die sichtbarste Antwort beim Durchlesen einzelner Beiträge, ist wesentlich für die Dezentrierung des lang anhaltenden Modells der Nation als grundlegende Einheit etwa von Wissensproduktionen, von Raumverständnis oder Vorstellungen von Zugehörigkeit verantwortlich. „Entgrenzung des historischen Gegenstandes“ bedeutet somit zunächst einmal immer auch eine Entgrenzung jenseits des Nationalstaates – auch wenn die Nation für die neuzeitliche Geschichte, wie der Historiker Kiran Klaus Patel betont hat, weiterhin eine bedeutsame Rolle spielt.[12]
Angesichts der Erkenntnis der Herausgeber/innen, dass sich die geographische Reichweite der historischen und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen verändert habe und eine Ausweitung internationaler Wissenschafts- und Forschungsnetzwerke stattfinde, wäre es zudem interessant gewesen zu erfahren, ob die Debatten zur transnationalen Geschichtsschreibung auch außerhalb „europäischer“ (oder zumindest „westlicher”, um diese problematischen Begriffe hier trotzdem zu verwenden) akademischen Institutionen mit einer derartigen Intensität geführt werden. Der Hinweis auf die Subaltern Studies mögen zwar ein Indiz dafür sein, aber die Auswahl der in diesem Band versammelten renommierten Autorinnen und Autoren – fast alle ausschließlich an „westlichen“ Institutionen forschend – lässt diese Frage offen. Interventionen aus den vielfältigen Wissenschaftscommunities dieser Welt würden möglicherweise die Perspektiven innerhalb der transnationalen Historiographie um einiges bereichern – oder in einem übertragenen Sinne: „there are only highly specific visual possibilities, each with a wonderfully detailed, active, partial way of organizing worlds.“[13]
Anmerkungen:
[1] Mar Castro Varela, Maria do; Dhawan, Nikita, Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung, Bielefeld 2005.
[2] Chakrabarty, Dipesh, Europa provinzialisieren. Postkolonialität und die Kritik der Geschichte, in: Conrad, Sebastian; Randeria, Shalini (Hrsg.), Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften, Franfurt am Main 2002. Ebenso: Chakrabarty, Dipesh, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton 2000.
[3]Chaterjee, Partha, Nationalist Thought and the Colonial World. A Derivative Discourse?, London 1986.
[4] Morris, Meaghan, Metamorphoses at Sydney Tower, in: New Formations, 11 (1990).
[5] Conrad, Sebastian; Randeria, Shalini (Hrsg.), Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften, Franfurt am Main 2002, S. 10. Ebenso: Young, Robert, Postcolonialism. An Historical Introduction, Oxford 2001.
[6] Siehe etwa die zu Beginn der 1990er-Jahre in den USA gegründete Latin American Subaltern Studies Group, die den Versuch unternimmt, die Lateinamerikastudien mit Hilfe einer postkolonialen Perspektive zu revidieren. Dazu: Rodríguez, Ileana (Hrsg.), The Latin American Subaltern Studies Reader, Durham 2001.
[7] Dazu auch: Zimmermann, Moshe, Wende in Israel: Zwischen Nation und Religion, Berlin 1996, S. 83ff. Er erinnert daran, dass der Holocaust im ersten Jahrzehnt nach der Staatsgründung Israels zunächst nur eine indirekte Rolle spielte. Je weiter das historische Ereignis in die Vergangenheit rückt, desto „imposanter schwebt es am ideologischen und politischen Himmel Israels.“
[8] Beispielsweise: Lukas, Richard D., The Forgotten Holocaust. Poles under the German Occupation 1939-1944, Lexington 1986 oder: Katz, Steven, Comparing the Armenian Tragedy with the Holocaust, in: Almog, Shmuel u.a. (Hrsg.), The Holocaust. The Unique and the Universal, Jerusalem 2001, S. 101-124.
[9] Siehe etwa Langer, Lawrence L., The Americanization of the Holocaust on Stage and Screen, in: ders., Admitting the Holocaust. Collected Essays, Oxford 1995; Cole, Tim, Images of the Holocaust. The Myth of the 'Shoah Business', London 1999.
[10] Levy, Daniel; Sznaider, Natan, Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust, Frankfurt am Main 2001.
[11] Locke, Hubert, Learning from History. A Black Christian's Perspective on the Holocaust, Westport 2000.
[12] Für eine eingehendere Erläuterung zur transnationalen Geschichte siehe: Patel, Kiran Klaus, Nach der Nationalfixiertheit. Perspektiven einer transnationalen Geschichte, (Öffentliche Vorlesungen der Humboldt-Universität zu Berlin, Bd. 128), Berlin 2004.
[13] Haraway, Donna, Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, in: dies., Simian, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, London 1991, S. 190.
Copyright (c) 2025 by Clio-online, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational use if proper credit is given to the author and to the list. For other permission, please contact hsk.redaktion