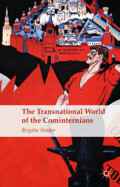Die Kommunistische Internationale, die Komintern, war mit ihrer globalen Tätigkeit und ihrem Ziel der Weltrevolution eine internationale Organisation, zugleich wegen des dichten Austausches von Personen transnational orientiert und schliesslich auf einen nationalen Raum ausgerichtet, in dem die politische Aktion stattfand (S. 4). Deshalb bietet es sich für Brigitte Studer – Professorin für Schweizer und Neueste Allgemeine Geschichte an der Universität Bern – an, die «transnationale Welt» der ausländischen Kommunisten in der Sowjetunion und namentlich derjenigen, die in der Komintern arbeiteten, zu untersuchen. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf dem Niedergang dieser Welt. Themen wie die Nachrichtendienste der Komintern, die Verbindungen zu aussenpolitischen Aktionen oder die Untergrundtätigkeiten, die ebenfalls transnationale Bezüge aufweisen, bleiben ausser Betracht. In ihrer Untersuchung greift Studer auf das umfangreiche autobiographische Material zurück, das diese Menschen bei der von ihnen geforderten «Arbeit am Selbst» (S. 18) hinterlassen haben und das nach der Öffnung der Archive in Russland zugänglich wurde.
Deutlich werden soll hierbei die «subjektive und emotionale Dimension» der Geschichte (S. 150), wobei eine Möglichkeit gewesen wäre, diese aus den Lebensgeschichten einiger weniger «Cominternians» heraus zu entwickeln. Studer hat sich für einen anderen Weg entschieden und aus den reichhaltigen Quellen Aussagen und Verhaltensweisen zahlreicher Personen ausgewählt, die sie dann je nach thematischer Ausrichtung in den entsprechenden Kapiteln anführt. Das hat den Nachteil, dass die Leserinnen und Leser nur wenig über das Leben dieser Menschen erfahren und die Belegstellen manchmal eher illustrativ wirken. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt aber auf der Hand: Es tritt eine Vielzahl von Aspekten differenziert hervor, die auf unterschiedliche Möglichkeiten und Handlungsalternativen hinweisen.
Studer schildert zunächst den institutionellen Kontext, das «bolschewistische Modell» (S. 22) und dessen Veränderungen in den 1920er und 1930er Jahren mit der Entstehung des stalinistischen Machtsystems, die Hoffnungen und Enttäuschungen, das «soziale Milieu» (S. 29) sowie die zunehmende Dominierung der nationalen Parteien. In all dem mussten sich die ausländischen Kommunisten in Moskau zurechtfinden. Ein besonderes Kapitel ist den Frauen gewidmet, denen sich in der Sowjetunion neue «berufliche, intellektuelle und kulturelle Möglichkeiten» (S. 40) eröffneten, die aber dann erleben mussten, dass sich traditionelle Geschlechterbilder mehr und mehr durchsetzten. Die Vorstellungen einer «Neuen Frau» erschöpften sich – anders als in den 1920er Jahren – in einem «zivilisierten» Verhaltenskodex («kul’turnost’», S. 51), der sich, trotz Gleichstellung mit dem Mann bei der Arbeit, auf Familie, Mutterschaft und herkömmliche Schönheitsideale gründete. Offenbar kam dies den Erwartungen vieler Frauen entgegen, zumal es mit grosser öffentlicher Anerkennung verbunden war. Die Kritik einer Anzahl Kommunistinnen, die infolge der Diskussionen in den 1920er Jahren zu einem neuen Genderverständnis vorgestossen waren, konnte keine Änderung bewirken.
Auf das in den 1930er Jahren durch Kontrolle, Überwachung und Repression zusehends eingeschränkte Alltagsleben reagierten die ausländischen Kommunisten unterschiedlich: Manche blieben trotz Enttäuschung überzeugt und enthusiastisch, andere machten einfach weiter und hofften auf bessere Zeiten, wenige wandten sich vom Sowjetkommunismus ab. Der Internationalismus endete auch formal mit der Verfassung von 1936. Nun wurden die Nation und das Russische betont, entsprechend sollten die ausländischen Kommunisten Russisch lernen. Zugleich wurde die Asylpolitik eingeengt.
Im Mittelpunkt des Buches stehen die «Techniken des Selbst» (Foucault), wie sie von den Kommunisten erwartet wurden und wie diese damit umgingen. Sie mussten mehrfach Fragebögen ausfüllen, Autobiographien und «Selbst-Berichte» (S. 73) schreiben, die von «Charakterisierungen» seitens des Apparates begleitet wurden. Bedeutete das Verfahren von «Kritik und Selbstkritik» (S. 74) ursprünglich eine selbstkritische Debatte innerhalb der Partei über soziale Übel, zum Beispiel den Bürokratismus, so bezog es sich nun auf die einzelne Person, die sich neben den schriftlichen Äusserungen auch öffentlichen Diskussionen stellen musste. Der Begriff der «Säuberung» erfuhr ebenfalls eine Veränderung: Aus einer «Reinigung» von Karrieristen, Opportunisten, säumigen Beitragszahlern und dergleichen, wie sie auch in anderen Parteien üblich war, wurde ein Instrument der Machtausübung gegenüber angeblichen «Abweichlern». Dies wirkte sich nachhaltig auf den Habitus der Betroffenen aus (S. 79, 94, 99, 140).
So hatten nun die internationalen Kader während ihrer Ausbildung zu lernen, eine «erfolgreiche Biografie» zu schreiben (S. 78), die Parteilinie «richtig» zu verstehen, die individuellen Interessen hinter den Interessen des Kollektivs und der Partei zurücktreten zu lassen sowie «Irrtümer» zu bekennen (S. 95, 100). Beaufsichtigt und beurteilt von Lehrern, Schul- und Parteileitung mussten sie in völliger Offenheit dem jeweiligen Kollektiv ihr Leben und Denken darlegen. Man durfte sich nicht einfach mehr mit jemandem treffen und sich von niemandem in der «Wachsamkeit» gegen «Abweichler» und «Schädlinge» übertreffen lassen, man musste jedes Wort auf die Goldwaage legen (S. 139). Dazu gehörte, dass man der Norm des «Neuen Menschen» so weit wie möglich entsprach, die jetzt – ähnlich wie bei der «Neuen Frau» – von äusserlichen Verhaltensmerkmalen der «kul’turnost’» ausging (S. 98). Diese sollten «internalisiert» werden, sonst drohte Repression (S. 106). Parteidisziplin stand über allem. Statt Irrtümer zu beseitigen, wurden vor allem seit 1936 diejenigen «liquidiert, die irrten» (S. 107).
Um die «Cominternians» besser kontrollieren zu können, wurde in den 1930er Jahren Druck auf sie ausgeübt, Mitglied der Sowjetpartei und Staatsbürger der UdSSR zu werden. Dies war mit erneuten biographischen Schriften und bürokratischen Überprüfungen durch eine spezielle Kommission und den sowjetischen Geheimdienst verbunden. 1937 warteten 5000 Mitglieder ausländischer Parteien auf die Überführung in die KPdSU (S. 87, vgl. 134, 141). Wer die Genehmigung nicht erhielt, musste mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen.
Privatheit gab es schliesslich nicht mehr, selbst nicht in sexueller Hinsicht. Was nicht öffentlich geschah, konnte ein Zeichen für politische Unzuverlässigkeit sein (S. 113, 118). Deshalb mischte sich die Partei «inquisitorisch» in das Leben ihrer Mitglieder ein (S. 110). War jemand als «Parteifeind» entlarvt, galten alle ihm nahe stehenden Menschen ebenfalls als verdächtig, weil sie seine «Schädlingstätigkeit» nicht bemerkt oder nicht gemeldet hatten. Ein vollständiger Bruch mit jenem war das mindeste, was erwartet wurde, und nutzte doch oft nichts. Im Übrigen wirkte sich hier noch einmal das Genderverständnis der Parteileitung aus: Männer wurden für gefährlicher gehalten als Frauen, zudem waren Frauen weniger in Führungspositionen vertreten. Daher fielen mehr männliche als weibliche Kommunisten dem stalinistischen Terror zum Opfer (S. 124).
Durch diese Entwicklung wurde die «transnationale Enklave» (S. 21) der ausländischen Kommunisten in der Sowjetunion zerstört. Diese wurden «von Genossen zu Spionen» (S. 126). Die Komintern galt als verdächtig, «Feinde» zu beherbergen. Gegenüber den «Fremden» formte sich ein Misstrauen, das für Jahrzehnte eine prägende Wirkung entfaltete (S. 126, 132). Ausländische Organisationen wurden aufgelöst. Es herrschte eine fremdenfeindliche, «paranoide Atmosphäre» (S. 141), welche die Identität der «Cominternians» fundamental destabilisierte (S. 140). Ihre «kosmopolitische Gesellschaft» (S. 142), etwa im Moskauer Hotel Lux, wurde ebenso aufgelöst wie jegliche persönliche Beziehung. An deren Stelle traten gegenseitige Verdächtigungen, Denunziationen, Isolierung oder gar Zerstörung der Persönlichkeit. Zu rechnen war mit Ausschluss aus der Partei, Verhaftung – auch von Familienangehörigen und Bekannten –, Folterung und Ermordung. Viele meldeten sich, keineswegs immer mit Erfolg, für den Kampf im Spanischen Bürgerkrieg oder für die Rückkehr in ihr Herkunftsland, um der Atmosphäre in Moskau zu entfliehen. Für andere bedeutete der stalinistische Terror einen vollständigen «geistigen Zusammenbruch». Unter den politischen Emigranten herrschte geradezu eine «apokalyptische Stimmung» (S. 139).
In ihrem «Epilog» (S. 144) gibt Studer einen knappen Überblick über die Auflösung der Komintern 1943 – eine Konsequenz aus der vorangegangenen Entwicklung –, über die Struktur des 1947 ins Leben gerufenen Kominform, das Kommunistische Informationsbüro, und über die weitere Geschichte des internationalen Kommunismus. Sie folgert, dass der Niedergang der Komintern nicht nur das Ende einer bedeutenden revolutionären Institution gewesen sei, sondern auch das Ende einer Hoffnung von Millionen Menschen und eines «transnationalen kulturellen Milieus» (S. 149). Einige, die den Terror überlebt hatten, machten die Verbrechen des Stalinismus öffentlich; die meisten aber schwiegen. Teilweise blieben sie vom Kommunismus überzeugt, wollten in der Zeit des Kalten Krieges nicht den Antikommunisten in die Hände spielen oder wollten ihre Überzeugungen nicht aufgeben, weil sie ihnen auch während der Repressionen Kraft gegeben hatten. Vermutlich führten aber nicht zuletzt die traumatischen Erfahrungen selbst dazu, dass über sie nicht gesprochen werden konnte.
Dass sich derart viele Menschen dem Druck beugten und ihren Habitus grundlegend änderten, macht immer wieder fassungslos, obwohl dieses Verhalten durch die Mechanismen der «Arbeit am Selbst», der Überwachung und der Bestrafung verständlich und nachvollziehbar wird. Brigitte Studer trägt durch ihre an Foucault und Bourdieu orientierte Analyse wesentlich dazu bei. Sie fasst mit diesem Buch ihre jahrzehntelange Forschung zusammen. Dabei greift sie auf schon früher publizierte Aufsätze zurück, die sie aber so überarbeitet hat, dass ein eigenständiges Werk mit nur gelegentlichen Überschneidungen entstanden ist. Für alle, die sich über den Zusammenbruch der «transnationalen Welt der Cominternians » informieren wollen, ist es ebenso unverzichtbar wie für die weitere Forschung.
Zitierweise:
Heiko Haumann: Rezension zu: Brigitte Studer, The Transnational World of the Cominternians, translated by Dafydd Rees Roberts, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte Vol. 66 Nr. 3, 2016, S. 496-498.